
Sonderlich viel Deutsch ist nicht hängen geblieben bei Jean-Pierre Bokondji alias Jupiter. Dabei ist er doch hierzulande aufgewachsen, als Diplomatensohn in Ost-Berlin, damals in den 60er und 70er Jahren. Aber nach mehr als 45 Jahren sind die Sprachkenntnisse „kaputt“, wie Jupiter lachend während des kurzen Interviews gesteht, das der Kongolese unmittelbar vor seinem „Over the Border“-Auftritt im Pantheon gibt. „Neger“, das kann er noch sagen, „Neger“, wie er damals von den Menschen auf der Straße bezeichnet wurde und wie er ein paar Jahre später seine erste Band nannte, in der die Musik seiner Heimat mit europäischem Rock fusionierte. Ja, Grenzen hat Jupiter schon zu jener Zeit nur zu gerne überschritten, und zwar teilweise wörtlich. „Wir lebten im Osten, aber meine Schule war in West-Berlin“, erzählt er. „Es war schon ironisch, dass ich als ’Neger’ die Mauer passieren durfte, während die Bürgerinnen und Bürger der DDR abgewiesen wurden.“
Werbeanzeige
Die Mauer ist mittlerweile weg, zumindest die eine – die in den Köpfen der Menschen halten sich leider weitaus länger als die aus Beton. Doch mit Musik lässt sich vieles erreichen. Davon kann Jupiter ein Lied singen. Mit 17 Jahren kehrt er zurück nach Kinshasa, in diesen kulturellen Schmelztiegel für die rund 250 verschiedenen Volksstämme des Kongo. Die meisten kongolesischen Künstler fokussieren sich lediglich auf die Rumba, Jupiter und seine Band Okwess (= Nahrung) auf den ganzen Rest. Für ihn sind die Rhythmen und Melodien aus den kongolesischen Dörfern die rohe Urform jener Rock-Musik, die er in Deutschland kennengelernt hat. Diese hat er sich in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten zu eigen gemacht, hat sie verbunden mit der Energie des Funk und der Tradition der Griot, jenen Geschichtenerzählern und Liedermachern Westafrikas, in dessen Tradition er sich ganz bewusst stellt. „Natürlich habe ich Botschaften, die ich vermitteln will“, sagt Jupiter. „Aber wenn sie politisch sind, kann ich sie nicht überall aussprechen. Dann muss ich auf Symbole oder Parabeln zurückgreifen.“ Und die Rhythmen sprechen lassen.
Artikel wird unten fortgesetzt
Mitte der 2000er Jahre beginnt die Musik von Jupiter & Okwess ihren Höhenflug. Künstler wie Damon Albarn, das Genie hinter Blur und den Gorillaz, oder Robert del Naja von Massive Attack werden auf die Band aufmerksam, was wiederum Touren über den gesamten Erdball ermöglicht. Sprachlich ist das mitunter schwierig, so wie auch im Pantheon: Die Ansagen, die der schlaksige Jupiter in einer konfusen Melange aus Deutsch und Französisch macht, helfen kaum, die Stücke inhaltlich zu begreifen. Die Musik dagegen, die versteht jeder. Die pulsierenden, vertrackten Rhythmen, die vor allem von Montana Kinunu Ntunu, dem Drummer mit der Luchador-Maske, und dem grimassierenden Bassisten Yende Balamba erzeugt werden, gehen unweigerlich in die Beine, und zwar unabhängig von Nationalität, Geschlecht oder Hautfarbe. Die Musik von Jupiter & Okwess soll eben frei machen, gleich machen und Spaß machen. Am besten alles auf einmal. Bei einem Stück, das die Gleichberechtigung von Frauen und Männern thematisiert, holt Jupiter kurzerhand ein paar Damen – und einen Herren – auf die Bühne, damit zumindest vorübergehend die Verhältnisse stimmen und dafür sorgen, dass der ganze Saal steht und tanzt. Diese Musik ist Energie für die Füße. Und Nahrung für die Seele.

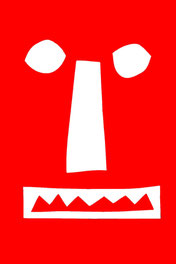









































































Kommentar schreiben